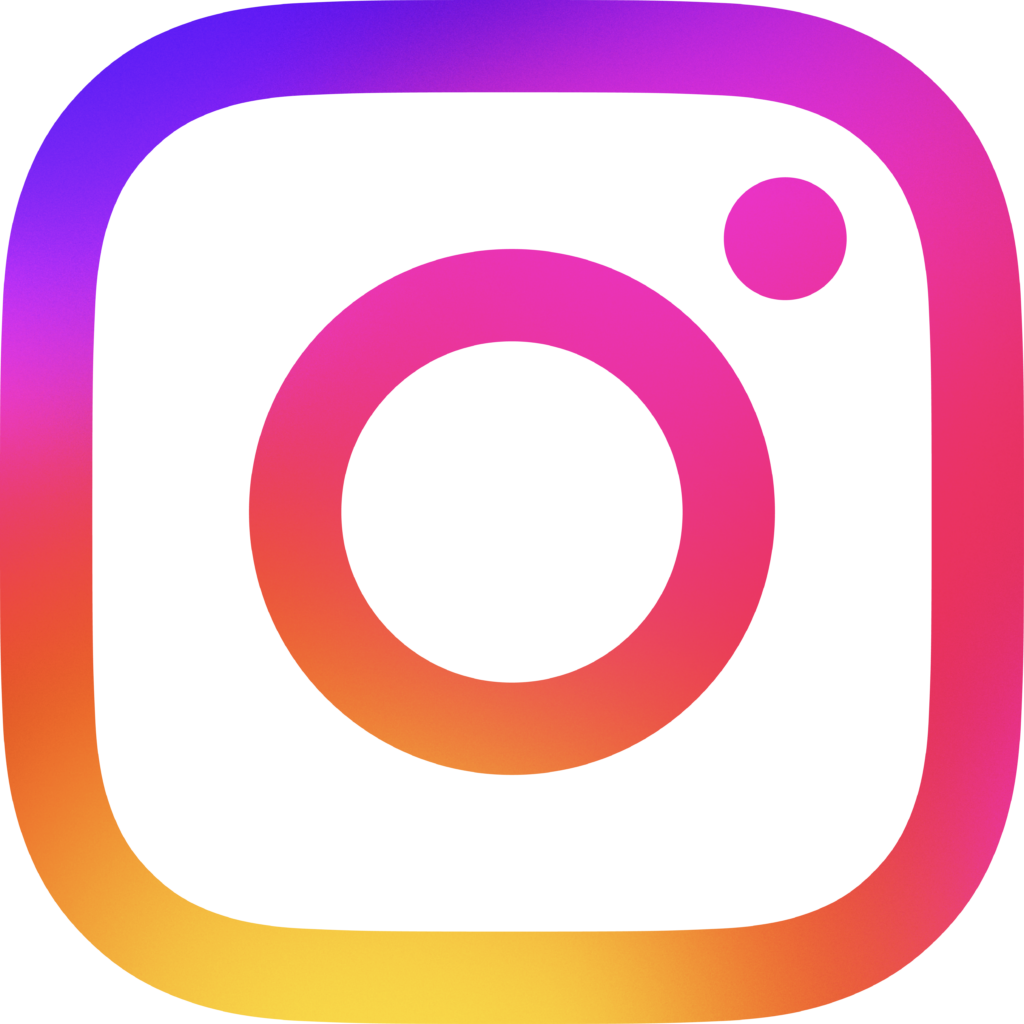Die österreichische Psychiatrie steht an einem Wendepunkt. Obwohl menschenrechtsbasierte Prinzipien durch internationale Leitlinien, etwa die UN-Behindertenrechtskonvention oder die WHO Quality Rights Initiative, längst eingefordert werden, ist ihre Umsetzung in der Praxis noch immer die Ausnahme. Der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Er verlangt nicht nur neue Haltungen, sondern tiefgreifende strukturelle und kulturelle Veränderungen. Was es dafür braucht, ist nicht bloß guten Willen, sondern systematische Unterstützung.
1. Coaching hin zu einer menschenrechtsbasierten Haltung
Ein Kulturwandel in der Psychiatrie lässt sich nicht durch einzelne Fortbildungen oder Dienstanweisungen herbeiführen. Es braucht kontinuierliches Coaching, das Teams darin begleitet, menschenrechtsbasierte Grundhaltungen im Alltag zu verankern, in der Sprache, im Handeln und in der Gestaltung von Beziehungen. Dabei geht es um mehr als bloße Techniken, es geht um ein gemeinsames Verlernen und Umlernen, um das Aushalten von Ambivalenz und um die Entwicklung eines neuen Verständnisses von Fürsorge, Verantwortung und Macht.
2. Prozessbegleitung zur Umsetzung der PreVCo-Empfehlungen
Die Implementierungsempfehlungen PreVCo Studie (2024) für die deutsche S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“ (DGPPN, 2018) liefern einen auf Evidenz und Expertenkonsens beruhenden Fahrplan zur Zwangsvermeidung. Doch kein Team kann diese komplexen Veränderungsprozesse ohne professionelle Begleitung umsetzen, besonders im stressbehafteten Stationsalltag. Veränderung erzeugt häufig auch Widerstand, besonders wenn sie in bestehende Routinen, Hierarchien und Traditionslinien eingreift. Ohne gezielte Moderation, Teamentwicklung und Supervision scheitern Transformationsprozesse häufig an genau diesen Hürden.
3. Verbindliche Evaluation der Umsetzung
Maßnahmen zur Zwangsvermeidung müssen nicht nur eingeführt, sondern auch überprüft werden: Werden sie im Alltag wirklich gelebt oder bloß formal abgehakt? Wie „authentisch“ sind z. B. Nachbesprechungen tatsächlich im Team verankert? Finden sie strukturiert, regelmäßig und in geschütztem Rahmen statt oder zwischen Tür und Angel während der Visite? Solche qualitativen Unterschiede entscheiden maßgeblich darüber, ob sich die Praxis wirklich verändert. Es braucht daher standardisierte Evaluationsinstrumente, Feedbackschleifen und Qualitätszirkel, die Umsetzung und Wirkung regelmäßig reflektieren.
4. Transparente Datennutzung und öffentliches Benchmarking
Österreich benötigt dringend eine offenere Datenkultur im Umgang mit Zwang. Daten zu Zwangsmaßnahmen müssen strukturiert, vergleichbar und öffentlich zugänglich gemacht werden. Erst dadurch wird Lernen voneinander möglich, sowohl zwischen Einrichtungen als auch innerhalb multiprofessioneller Teams. Ein öffentliches Benchmarking fördert Austausch, Inspiration und den Mut zur Veränderung. Gleichzeitig erhöht es den Druck auf Einrichtungen, sich nicht mit dem Status quo zufriedenzugeben.
5. Verankerung von Zwangsprävention im zukünftigen Unterbringungsgesetz (UbG)
Die Implementierung der PreVCo-Empfehlungen muss gesetzlich verankert werden, nicht als Option, sondern als Voraussetzung: Nur Einrichtungen, die nachweislich alle strukturellen und personellen Maßnahmen zur Zwangsprävention umsetzen, sollten überhaupt berechtigt sein, Zwang auszuüben. Denn nur dann kann sichergestellt werden, dass Zwang tatsächlich das letzte Mittel bleibt. In der Praxis zeigt sich, dass Psychiatrien höchst unterschiedlich in der Umsetzung von Prävention engagiert sind. Ohne gesetzliche Verpflichtung bleiben viele Einrichtungen in ihren eigenen Traditionen verhaftet, oft verstärkt durch starre Hierarchien, Ressourcendruck und eine Kultur des: „Das haben wir schon immer so gemacht.“
6. Ambulant vor stationär: Alternativen aufbauen
Österreichs psychiatrische Versorgungslandschaft ist nach wie vor stark stationär geprägt. Was fehlt, sind flächendeckende, gemeindenahe und niedrigschwellige Alternativen zur Akutpsychiatrie, also genau jene Angebote, die präventiv wirken und Zwangsmaßnahmen oftmals überflüssig machen könnten. Internationale Modelle zeigen, dass es anders geht:
- Soteria-Häuser bieten Menschen in psychischen Krisen eine wohnliche, nicht-klinische Umgebung mit Gartenzugang, Partizipation von Genesungsbegleiter*innen, einer betont beziehungsorientierten Haltung und einem zurückhaltenden Umgang mit Psychopharmaka.
- Weglaufhäuser, aus der Nutzer*innenbewegung entstanden, werden von Menschen mit eigener Psychiatrieerfahrung geführt. Sie bieten Rückzugsräume in akuten Lebenskrisen, in denen auf Zwang verzichtet wird. Die freiwillige, peergetragene Struktur fördert Selbstbestimmung, Vertrauen und individuelle Krisenbewältigung.
- Peer Respite Homes sind kurzfristige, freiwillige Kriseneinrichtungen, in denen Betroffene für einige Tage Zuflucht finden können, ohne formale Aufnahmeprozeduren, Diagnosedruck oder Medikamentenzwang. Peers begleiten vor Ort und schaffen einen Raum, in dem Unterstützung nicht kontrollierend, sondern solidarisch erlebt wird.
- Home Treatment-Teams bzw. stationsäquivalente Behandlungen (StäB) bieten intensive, aufsuchende Unterstützung im eigenen Wohnumfeld. Multiprofessionelle Teams begleiten Menschen während psychischer Krisen dort, wo sie leben. Diese aufsuchende Hilfe ermöglicht Kontinuität, reduziert Belastungen durch Klinikaufenthalte und stärkt die Alltagsintegration.
All diese Modelle setzen auf Freiwilligkeit, Beziehung statt Kontrolle
und auf eine Haltung, die psychische Krisen als zutiefst menschliche
Erfahrungen begreift und nicht als Störungen. Ihr Potenzial reicht weit über den individuellen Nutzen hinaus. Viele dieser Einrichtungen funktionieren ohne oder lediglich mit ärztlichem Konsiliardienst. Auf diese Weise wird der subakute stationäre Bereich der Psychiatrie nachhaltig entlastet, wodurch dringend benötigte ärztliche und pflegerische Fachpersonen gezielt im Akutsetting eingesetzt werden können. Dies stärkt die Versorgungsqualität insgesamt und sichert die Handlungsfähigkeit des Systems. Zusätzlich ermöglicht ein verbesserter Personalschlüssel auf den Akutstationen die nötigen Spielräume, damit eine menschenrechtsbasierte Haltungsänderung nicht nur eingefordert, sondern auch tatsächlich gelebt werden kann.
Eine menschenrechtsorientierte Psychiatrie ist keine Utopie, sondern eine Aufgabe, die mit klaren Strukturen und gemeinsamer Anstrengung erreichbar ist. Veränderung braucht Mut, aber auch konkrete Ressourcen, politische Rückendeckung und kontinuierliche Prozessbegleitung. Jetzt ist der Moment, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und den Wandel aktiv zu gestalten.
Die Initiative Transparente Psychiatrie basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Damit wir unsere Aufklärungsarbeit, unsere Website und die laufende Öffentlichkeitsarbeit weiterführen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, hilft uns, Missstände sichtbar zu machen und Veränderungen anzustoßen. Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.
Spendenkonto
Transparente Psychiatrie
Sparkasse der Stadt Feldkirch
IBAN: AT54 2060 4031 0332 8203
BIC: SPFKAT2BXXX
Literaturverzeichnis:
DGPPN, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (2018): S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“. Berlin, Heidelberg. Online unter https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/154528053e2d1464d9788c0b2d298ee4a9d1cca3/S3%20LL%20Verhinderung%20von%20Zwang%20LANG%2BLITERATUR%20FINAL%2010.9.2018.pdf abgerufen am 05.08.2025
PreVCo Studie (2024). Empfehlungen für psychiatrische Stationen (12 Punkte-Programm). Online unter: https://www.prevco.de/Prevco/12punkte.pdf abgerufen am 05.08.2025